La Ferme du Grand Laval: Landwirtschaft trifft Wildnis
Die Landwirte des französischen Bauernhofs „Grand Laval“ versöhnen die Landwirtschaft mit der Natur. Sie stellen nicht nur Nahrungsmittel her, sondern produzieren auch „Wildnis“. 2200 Wildpflanzen, Insekten, Amphibien, Nutztiere und anderen Organismen haben auf dem Hof einen Lebensraum gefunden.
Wenn der Mensch die Natur machen lässt und ihr auf Bauernhöfen mehr Feld überlässt, geschehen erstaunliche Dinge. Davon kann man sich auf der „Ferme du Grand Laval“ überzeugen, die sich in der Region Auvergne Rhône-Alpes befindet. „Ihr müsst nur den nummerierten rosafarbenen Pfosten folgen, um zu erleben, wie Landwirtschaft und Natur bei uns ineinandergreifen“, sagt Elsa Gärtner. Sie und ihr Mann Sébastien Blache betreiben den Hof und haben die Pfosten in den Boden gehauen, um einen Rundgang zu markieren. Start ist bei einem Weizenfeld, in dem auch Mohn, Gewöhnliche Vogelmiere, Kornblumen, Männertreu, Kornrade und weiß blühende Acker-Schmalwand wachsen. Es sieht wild aus. Die Landwirtin fordert Besucher auf, Reptilienplatten umzudrehen. Eine Platte am Wegesrand besteht aus Gummi und einem Textilgemisch und ähnelt einer Fußmatte. Gaspar, der älteste Sohn, ist beim Rundgang dabei und lupft die Platte ein kleines Stück. Drei Schlangen springen blitzschnell davon.
Der Hof „Du Grand Laval“ gehört zur „Association des fermes paysannes et sauvages“, einem Verein, der sich für mehr Wildnis auf Bauernhöfen einsetzt. Mehr Wildnis auf Bauernhöfen? Das klingt wie die Quadratur des Kreises. Doch Elsa Gärtner und ihre Mitstreiter und Mitstreiterinnen zeigen, wie sich karge Äcker in eine artenreiche und widerstandsfähige Natur zurückverwandeln lassen. Das ist umso beeindruckender, als es schlecht um unsere Landschaften bestellt ist, besonders um die Flächen, die für Viehzucht und Ackerbau genutzt werden. So lautet das Ergebnis des Berichts zum „Zustand der Natur in den EU-Ländern“ aus dem Jahr 2020, nach dem sich 81 Prozent der Lebensräume in der EU in einem mangelhaften Zustand befinden; wie einst die Farm du Grand Laval.
Die Rückkehr der Arten
„Als mein Mann im Jahr 2006 den Hof übernahm, war hier alles kahl“, sagt Elsa. Sie hat alte Fotos herausgesucht, um den Vorher-Nachher-Zustand zu dokumentieren. Ein Bild zeigt ein kahles Stück Land. Es liegt ein wenig Schnee. „So sahen unsere Äcker einst aus, es gab weder Sträucher noch Bäume, um das Land ungehindert mit Traktoren befahren zu können“, erläutert die Landwirtin. „Es wurden nur zwei Kulturen angebaut: Weizen für die menschliche Ernährung und Mais, um Tiere zu füttern.“ Rechnet man Wildkräuter und Insekten mit ein, die sich behaupten konnten, obwohl die Bauern Pestizide spritzten, lebten auf den Äckern schätzungsweise 50 Arten. Heute dient das Stück Land immer noch der Landwirtschaft, es wirft aber eine breite Palette an Gemüse, Obst und Getreide ab – Elsa, ihr Mann und die drei Kinder können von den Erlösen leben. Insgesamt existieren auf der Fläche mehr als 2200 Organismen. Die Artenvielfalt ist explodiert; das Konzept des Vereins für mehr Wildnis auf Bauernhöfen ist aufgegangen.



Wildnis bedeutet, dass der Mensch nicht eingreift, dass er keinen umgefallenen Baumstamm wegräumt und keinem verletzten Tier hilft. Dieses Prinzip wenden die französischen Landwirte nur auf der einen Seite des Wegs entlang der rosafarbenen Pfosten an. Dort bilden Bäume und Gebüsch einen Streifen, der wie dichter Urwald wirkt. Auf der anderen Seite liegen Parzellen, in denen Raps, Linsen, Erbsen, Bohnen, Luzerne, Gerste, Hafer, Sonnenblumen, Kichererbsen, Klee, Hirse und weitere Kulturen einzeln oder in Kombination angebaut werden. Hier wird die Natur zwar nicht sich selbst überlassen, aber die Landwirte wirtschaften nach Konzepten, die sie der Wildnis abgeschaut haben: Wie in einem natürlichen Wald lassen sie viele verschiedene Pflanzen gedeihen. Selbst wenn es Nutzpflanzen sind, zieht ihre Vielfalt in der Regel auch zahlreiche Insekten und andere Tiere an. Die Diversität hält die Systeme stabil. Werden einige Arten durch Hitze, Kälte oder Insektenplagen beeinträchtigt, können andere Arten den Verlust auffangen. Außerdem macht die Vielfalt der Kulturen den Hof auch wirtschaftlich resilient: „Der Raps bringt öfter keine gute Ernte“, erläutert Gärtner, „er muss Ende August gesät werden, doch dann gibt es immer so viel zu tun, dass wir meist zu spät dran sind.“ Weil das Paar aber eine breite Palette an Nahrungsmitteln anbaut, die sie dienstags und samstags im Hofladen verkaufen, fallen Ernteausfälle beim Raps finanziell kaum ins Gewicht.
Zwischen den verschiedenen Parzellen lassen Elsa und ihr Mann wilde Hecken wuchern. Sie bieten Spinnen, Nacktschnecken, Insekten und vielen anderen Arten einen Lebensraum. Noch nie sind in der Geschichte der Menschheit so viele Arten ausgestorben. Schon heute leben weltweit schätzungsweise 20 Prozent weniger Arten als zu Beginn des 19. Jahrhunderts. In Deutschland und einigen Regionen Frankreichs stehen selbst Tiere wie der Feldhase oder der Iltis, die einst weit verbreitet waren, auf der Roten Liste. In Elsas Hecken können sie Unterschlupf finden. „Wir schneiden sie nicht zurück, sondern lassen sie immer weiterwachsen“, sagt die Französin. Das Gestrüpp zwischen den Parzellen ist bis zu fünf Meter breit. Wieviel Wildnis verträgt die Farm? „Sobald unsere Produktion gefährdet wird, ist eine Grenze erreicht“, erläutert Elsa Gärtner.
Natürliche Insektenvielfalt schützt vor Schädlingen
Viele Jahre dachte sie, dass sie gegen den Apfelwickler vorgehen muss, um ihre Äpfel zu schützen. Der gräuliche Nachtfalter mit hellen Streifen auf den Flügeln legt flache weiße Eier, aus denen Raupen schlüpfen, die die Früchte befallen. „Um das zu verhindern, haben wir Carpovirusine gespritzt“, berichtet die Landwirtin. Dieses Insektizid darf in der Bio-Landwirtschaft verwendet werden, denn das Mittel schont Bienen und Nützlinge wie Florfliegen, Schlupfwespen und Marienkäfer. Doch es schädigt neben dem Apfelwickler auch andere Nachtfalter: „Das gab uns zu denken“, erinnert sich Elsa. Um sich einen Überblick über die Nachtfalter-Populationen zu verschaffen, arbeitete sie mit einem Insektenforscher zusammen. Gemeinsam hängten sie im Obstgarten weiße Laken auf und warteten, bis es dunkel wurde. Dann beschienen sie die Laken mit ultraviolettem Licht. Das lockte die Flattertiere an. Sie setzten sich auf die weißen Stoffe, wo sie gezählt und bestimmt werden konnten. Das Team wiederholte den Vorgang im Lauf von fünf Nächten und fand dabei tausende Nachtfalter verschiedener Arten. „Darunter nur zwei oder drei Apfelwickler“, erinnert sich Gärtner. Sie und ihr Mann beschlossen, auf den Einsatz von Carpovirusine zu verzichten.
„Wir verstanden, dass uns die Wildnis beim Apfelanbau nutzt.“
Die natürliche Vielfalt von Nachtfaltern ist ein guter Schutz gegen den Apfelwickler: Die verschiedenen Arten füllen die Nische der Nachtfalter aus und lassen somit nur wenig Platz für den Schädling. Er gehört mit dazu, doch sein Bestand bleibt klein und der Schaden gering. Doch Elsa Gärtner nutzt nicht nur die Vielfalt der Insekten. Auch Hühner sind ihre Helfer.



Zurzeit sind in Gärtners Obstgarten nur Kirschen reif. Gaspard pflückt welche. Sie schmecken süß. An dieser durch einen weiteren Pfosten markierten Station picken Legehennen nach Insekten oder Fallobst und halten dabei die Pflanzendecke kurz. Somit verhindern sie, dass der Garten verunkrautet, was das Wachstum von Bäumen oder Früchten beeinträchtigen würde. „Und wir können auf den Einsatz von Mulcher oder Motorsense verzichten“, erklärt die Landwirtin. Sie läuft auf einen Bauwagen zu, den sie als Hühnerstall nutzt, um Eier, die die Hühner dort in kleine Nester legen, einzusammeln. „Sie bereichern den Boden mit ihrem Kot“, erklärt sie. „Das Beste daran ist, dass sie ihn selbstständig überall verteilen. Wer schon einmal große Mengen Mist mit Schubkarren und Mistgabeln bewegt hat, weiß wie viel Arbeit das spart.“
Breite Bäche beugen Hochwasser vor und helfen bei Dürre
Den Weg zum Schafstall versperrt ein Bach. „Bis vor Kurzem war das nur ein kleines Rinnsal“ erläutert Elsa, „aber wir haben ähnlich wie ein Biber aus Erde, Pflanzenabfällen und Holz Hindernisse gebaut.“ Ziel war, den Wasserstand zu erhöhen, um das Wasser länger in der Landschaft halten zu können. „Bei Hochwasser saugen Bach und Böschung wie ein Schwamm das Wasser auf und bei Dürre gibt der Bach das Wasser langsam an das angrenzende Land ab, so dass es länger feucht bleibt“, erklärt Gärtner. An vielen Stellen haben Gärtner und ihr Mann kleine Teiche angelegt. Somit haben sie Feuchtigkeit aufs Land zurückgeholt. „Fotofallen zeigen uns, dass das Wasser Insekten und viele Vögel anzieht. Sie trinken und baden hier.“
„Wir können diese Inseln und Oasen nicht retten, wenn wir das Land rundherum nicht besser schützen.“
Im Schafstall steht ein Esel. Er ist betäubt, ein Tierarzt schneidet ihm die Hufe. Sébastien Blache, Elsas Mann, hilft ihm. Und Camille, der mittlere Sohn, guckt zu. „Es kommen auch öfter Freunde auf den Hof“, erzählt die Französin, „sie erholen sich hier, denn für sie sind wir ein Zeichen der Hoffnung.“ Doch der Hof tut nicht nur einzelnen Menschen gut, sondern bringt auch messbare Erfolge für den Umweltschutz. Um diese nachzuweisen, ziehen die Landwirte im Rahmen des Projekts „Reensauvager la Ferme“ (die Zurückverwilderung der Farm) Indikatoren wie den „Grassland Butterfly Index“ heran, bei dem sie Grünland-Schmetterlinge zählen. Warum diese Arten? Weil sie auf bestimmte Pflanzen, die sie bestäuben, angewiesen sind. Wer diese Arten zählt, zählt die Diversität der Pflanzen quasi gleich mit. Außerdem reagieren sie sehr empfindlich auf Beeinträchtigungen der Ökosysteme, deshalb sind die Bestände in der EU von 15 typischen Schmetterlingen zwischen 1991 und 2020 um 30 Prozent geschrumpft. „Bereits vor 1991 gab es erhebliche Rückgänge bei der Häufigkeit und der Vielfalt der Arten“, teil die Europäische Umweltagentur mit. Selbst in Naturschutzgebieten schrumpft der Schmetterlingsreichtum. Das zeigt: „Wir können diese Inseln und Oasen nicht retten, wenn wir das Land rundherum nicht besser schützen“, sagt Bernd Hansjürgens vom Helmholtz Zentrum für Umweltforschung. Der Umweltökonom begleitet ein Projekt rund um das Stettiner Haff, bei dem auf 450 000 Hektar Land wieder mehr Wildnis entstehen soll. Er weiß, dass es nicht genügt, nur Wälder oder Flusslandschaften zu renaturieren. Auch Bauern und Bäuerinnen müssen ran: Felder, Obstgärten, Weiden und Wiesen, die in Deutschland und Frankreich die Hälfte der Landesfläche ausmachen, müssen „wilder“ werden, um den Verlust der Artenvielfalt zu bremsen.
Schmetterlingsbeweis
Auf dem Hof haben ehrenamtliche Mitarbeiter die Schmetterlinge gezählt und kamen zu dem Ergebnis, dass auf Flächen, die seit 2006 bewirtschaftet werden, „signifikant mehr Schmetterlinge vorkommen als durchschnittlich in anderen Regionen im Südöstlichen Frankreich“, erläutert der Naturforscher Maxime Zucca in einem Bericht. „Doch es ist noch zu früh, um festzustellen, ob einige der Arten, die auf nationaler Ebene zurückgehen, auf der Farm zunehmen.“ Er betont aber, dass der Sichelbläuling regelmäßig auf der Farm zu beobachten sei, obwohl er zu den Arten gehört, die in Frankreich am stärksten bedroht sind.
Von Elsas und Sebastiens Hof aus kann man direkt auf die Ausläufer des Vercors sehen, eines Gebirges, das den französischen Alpen vorgelagert ist. Ihr Stück Land hebt sich von der Monotonie der umliegenden Agrarlandschaft ab, auf der fast ausschließlich Getreide angebaut wird. Langfristig könnte sich dies jedoch ändern. Nach Flutkatastrophen im Frühjahr 2024, die besonders in Süddeutschland und Österreich große Schäden hinterließen, wurde überraschend das EU-Renaturierungsgesetz, das Nature Restauration Law, verabschiedet, das im März 2024 auf Eis gelegt worden war. Es verpflichtet die Mitgliedstaaten zum Beispiel zur Wiederherstellung ihrer Flüsse. Renaturierte Flussläufe sind ein guter Hochwasserschutz. Auch Wälder, Seen, Moore, Meere und Wiesen sollen renaturiert werden. Bauern und Bäuerinnen sind aufgefordert, naturnäher zu wirtschaften und mehr Vielfalt zuzulassen. Aufgrund von Protesten gab es jedoch viele Zugeständnisse an die Landwirtschaft. Dabei bedeutet mehr Wildnis auf dem Acker auch, die Natur für sich arbeiten zu lassen, ohne Verluste für die Landwirtschaft einzufahren. Auf der Ferme du Grand Laval kann man sehen, dass dies möglich ist.



Text: Stephanie Eichler
Fotos: Emanuel Herm
Dieser Beitrag erschien in Werde 03/2025.
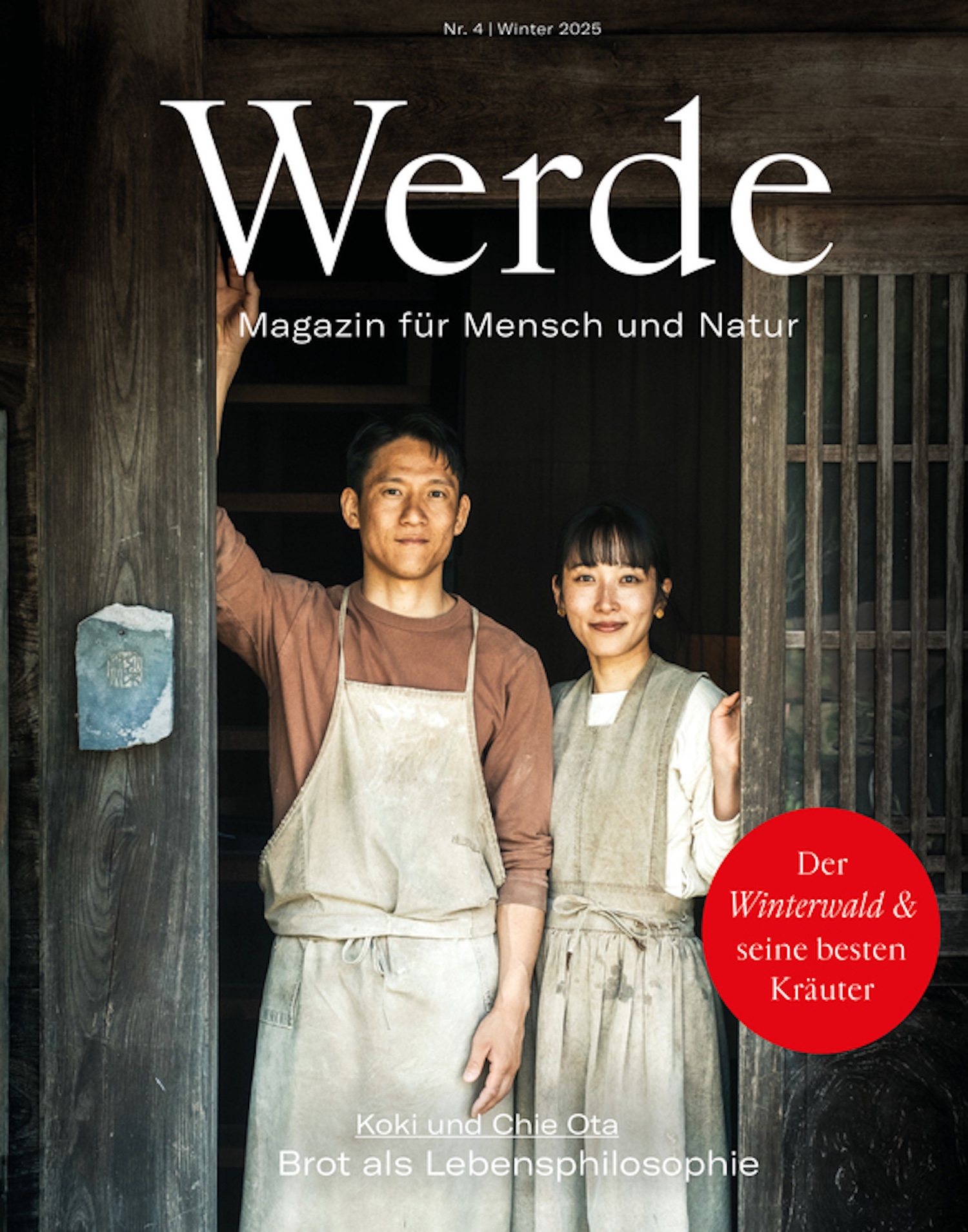
Die aktuelle Ausgabe nimmt uns mit auf Wege in die Natur, die vom Wald und Holz geprägt sind.
So begleiten wir Bootsbauer Philipp Schwitalla, der mit viele Liebe zum Detail Holzschiffe baut. In den Wäldern der Karpaten treffen wir auf Wisente, deren Auswilderung eine Initiative ermöglicht, die wir in dieser Ausgabe vorstellen.
Kräuterexpertin Dajana Krüger zeigt, warum unsere heimischen Nadelwälder wahre Schatzkammern für Heilpflanzen und winterliche Rezepte sind.
Plus: Exklusive Interviews, Rezepte und spannende Reportagen über traditionelle Handwerkskunst wie die japanische Kunst des Kintsugi – die uns zeigt, wie Zerbrochenes zu etwas Neuem und Schönem wird.
Weitere Artikel
- Beitrag, Stories
- Mensch & Gesellschaft
- Mensch & Gesellschaft
- Mensch & Gesellschaft
- Mensch & Gesellschaft
- Mensch & Gesellschaft