Friedmunt Sonnemann bewohnt seit mehr als 20 Jahren ein Lehmhaus im Wald. Was er an Geld braucht, verdient er mit der Zucht und dem Verkauf von Saatgut seltener Pflanzen
Text Andrea Freund Foto Bernd Jonkmanns

„Folgt am Ortsausgang von Longkamp einer scharfen Kehre nach links, dann einem Feldweg über die Hochebene bis zum Waldrand. Auf einer Schotterpiste geht’s in den Wald hinein, biegt an der dritten Ecke links ab, fahrt weiter durch den Wald, auf die offene Flur, wieder in den Wald hinein, und auf einer Kuppe, in einer jungen Douglasienpflanzung, endet der gute Belag. Hier geht es auf einem Waldweg steil zu uns herunter.“ – „Falls wir uns doch verfahren, hat das Handy dort Empfang?“ – „Zum Glück nicht!“

Der Mann im Wald
Wir wollen zu Friedmunt Sonnemann. Dem Mann im Wald. Seit mehr als 20 Jahren lebt er dort ohne Strom, also ohne Internet, Facebook, TV, Kühlschrank, Elektroherd und Waschmaschine. Sein Trinkwasser holt er aus einer Quelle, zum Duschen schöpft er Wasser aus einer Regentonne. Dass er Telefon hat, verdankt er der Bundespost, die früher für 100 D-Mark jeden Anschluss legte. Egal wohin. Auch in den tiefsten Hunsrück, wo er seltene und in Vergessenheit geratene Kulturpflanzen züchtet, deren Samen er verkauft. Eine Wickenart zum Beispiel, die schon in der Steinzeit angebaut wurde.
Seine „Königsfarm“ gehört zum Gebiet von Longkamp, und diese kleine Gemeinde hatte das Navi auch problemlos gefunden. Longkamp, 1.100 Einwohner, gut acht Kilometer vom Weinort Bernkastel-Kues an der Mosel entfernt und 50 nordöstlich von Trier. Aber die Königsfarm? Kein Eintrag. Also folgen wir der Routenbeschreibung, rollen zwischen Hügeln mit Wiesen und Raps dem Waldrand entgegen und staunen: Handgeschnitzte Schilder weisen verlässlich die Richtung.
Ein Mann mit Bart und langen Haaren, barfuß und in zerschlissenen Klamotten, sehr aufrecht, begrüßt uns freundlich.
Kurz vor dem Ziel setzt der Wagen fast auf dem feuchten Waldboden auf. Eine Kröte verkriecht sich im Laub am Wegesrand. Wir stoppen in einer Kuhle vor einer großen Scheune und einem Holzgatter aus geschwungenen Ästen. Zwischen blau blühenden Vergissmeinnicht und weißer Sternmiere führt ein Pfad in einen verwunschenen Garten mit Beeten und üppigem Grün. Ein Mann mit Bart und langen Haaren, barfuß und in zerschlissenen Klamotten, sehr aufrecht, begrüßt uns freundlich: „Friedmunt.“ Er ist keiner, der viel redet. Friedmunt wohnt in einem kleinen Lehmhaus unter einer mehr als 200 Jahre alten Eiche, von der sich ein großer Ast auf das Dach zu stützen scheint. Oder duckt sich die Behausung im Schutz des gewaltigen Baumes?

Drinnen staunen wir zum zweiten Mal. Nicht, weil die langen Schatten des Nachmittags das Licht schon etwas dämmrig machen. Weich fällt es auf einen großen, selbst gemauerten Specksteinofen, einen Holztisch, einen großen Ofen mit Töpfen und Kannen, den Korb mit Holzscheiten davor und den mit dicken Mützen an der Seite. Auf das Telefon an der Wand, mit Wählscheibe und so hellbeige, als ließe die Zeit es allmählich verblassen. Wir staunen, weil kurz darauf die Tür aufgeht und drei Jugendliche aus Longkamp hereinkommen: „Wir wollten nur mal gucken“, sie hätten über Friedmunt in der Zeitung gelesen. Manchmal heißt es dort, er sei ein Einsiedler. Aber von allem, was man über Friedmunt sagen kann, stimmt das wohl am wenigsten.
Naturnahes Leben
Auf der Königsfarm, die ursprünglich einem Winzer namens König gehörte, lebt er mit einem jungen Paar, das sich einen Bauwagen teilt: Ursula, die gerade verreist ist und draußen vorm Fenster einen Strauß Wildblumen in ein Glas gestellt hat, und Ullrich, der abends gern Harfe spielt. Er hat seit zwei Wochen Wieland zu Besuch, einen Freund aus der Nähe von Stuttgart. Am Nachmittag waren noch Friedmunts Bruder und seine Familie da. In Bernkastel-Kues wohnen Friedmunts Frau, die einst aus bunten Kachelresten ein fast orientalisches Muster über dem Ofen und der Spüle gestaltet hat, und der gemeinsame Sohn. Nach Kinderjahren im Wald ohne elektronische Medien arbeitet er heute in der IT-Branche, seine Schwester lebt als Game-Entwicklerin in Berlin.
Schwarz und still liegt der Wald, unheimlich still.
Manche Besucher bleiben länger, weil sie, wie Friedmunt sagt, „Veränderung suchen und den Weg nicht finden“. Zweimal im Jahr, in den Monaten Juli und August, ist die Königsfarm zudem Schauplatz eines internationalen Workcamps zum Erhalt biologischer Artenvielfalt. Service Civil International (SCI) verschweigt weder das Kompostklo noch die ausschließlich vegetarische Ernährung oder die sechs Stunden körperliche Arbeit täglich. Interessenten sollen statt Rollkoffer einen Rucksack mitbringen und den „festen Willen, das naturnahe Leben zwei Wochen lang durchzustehen“.



Den haben wir für 24 Stunden. Noch im Hellen verabschiedet sich Friedmunt, er sei müde. Wir rollen unsere Schlafsäcke in einem Lehmhaus mit zwei alten Betten aus, Ullrich bringt uns einen Armvoll Kerzen, aber auch die machen wir bald aus. Es ist vielleicht halb zehn. Schwarz und still liegt der Wald, unheimlich still, zweimal höre ich ein Flugzeug, der Flughafen Frankfurt-Hahn ist nur rund 15 Kilometer Luftlinie entfernt. Und dann erinnere ich mich nur noch an das Säuseln des Regens auf den Blättern der Buchen.
Morgens weckt uns Punkt sieben ein Kuckuck, noch ehe Friedmunt aus seinem Häuschen kommt. Im orangefarbenen selbst gestrickten Pulli mit Sonnenmotiv schreitet er langsam zwischen den Beeten entlang, wo die Regentropfen noch auf den Blättern der Pflanzen glitzern. Panflöte spielend dreht er eine langsame Runde zu Ullrichs Bauwagen, Wielands Bauwagen, „unserem“ Lehmhaus, vorbei am Gewächshaus mit den vorgezogenen Samen: Frühstück ist fertig. Es gibt Haferflocken, Ölsaaten zum Selbstschroten, schrumpelige Bio-Äpfel, Reismilch, bitteren Bärwurz- und Anis-Ysop-Tee aus dem Garten. Friedmunt segnet das Essen, „zu unserem Wohl und zum Wohle aller“. Auf dem Ofen simmert leise das Wasser, niemand spricht. Zu unseren Füßen vergnügt sich Katze Sonja mit einer Maus.
Die Zeit scheint hier träger zu fließen. Was ist heute, Donnerstag?
Keine Uhr strukturiert den Tag, es gibt kein Müssen, kein Fertigwerdensollen mit irgendetwas. Orientierung gibt am ehesten noch ein Kalender mit planetarischen Rhythmen, dem auch anthroposophisch arbeitende Landwirte folgen. Für den nächsten Tag kündigt er ein Trigon zwischen Mond und Jupiter an, das die Aussaat begünstigen soll. Friedmunt will deshalb heute die Beete für die Feinsaaten vorbereiten, für Thymian, Bohnenkraut, Amerikanische Bergminze und erstmals auch – als Versuch – Currykraut, dessen Samen bisher noch niemand anbiete.
Nur keine Hektik
Und er will den jungen Bohnenpflanzen ein paar Stangen setzen. Gemessenen Schrittes geht er los, entlaubt lange, starke Triebe eines Kirschbaums, haut sie am unteren Ende spitz zu, um sie auf einem kleinen Feldstück unterhalb des Hauses in der Erde verankern zu können. Am oberen Ende lässt er ein paar Blätter wie kleine Wimpel stehen. Einen nach dem anderen bearbeitet er, trägt ihn wortlos aufs Feld, senkt ihn in die Erde, zieht wieder los, um den nächsten anzufertigen. In aller Seelenruhe. Hektik? Klingt wie ein Fremdwort aus einer anderen Welt.
Dorthin muss Wieland am nächsten Tag zurück. Er erinnert sich noch, wie „aufgeregt“ er bei seiner Ankunft war. Inzwischen fragt er sich ernsthaft, „ob ich noch irgendetwas hinbekomme“ (an diesem Morgen übrigens eine Treppe in Landart-Manier). Die Entdeckung der Langsamkeit kann offenbar auch Angst machen. Trotzdem: „Mit einem Ticket nach sonst wohin hätte ich all das nie erfahren“, sagt er.

Wie geborgen er sich im Wald gefühlt hat und wie selbständig man dort doch leben könne – von Bio-Kisten, die angeliefert werden, und jeder Menge gesundem Wildkräutersalat, etwa mit Knoblauchsrauke, Kantenlauch, Süßdolde, Orangenminze oder Fetthenne. Auch Ullrich ging es so, als er nach Jahren der Umtriebigkeit hier im Wald seine Wurzeln fand. „Über den Kontakt mit der Natur hab ich mich zum ersten Mal selbst wirklich gespürt“, erzählt er. Der Oberösterreicher kann nichts anfangen mit Zentralheizungen und Wasserleitungen, mit Obst und Gemüse aus dem Supermarkt, bei denen doch immer die Herkunft im Unklaren liegt: „Hier aber sehe ich alles wachsen, kann jeden Schritt mit allen Sinnen verfolgen, hier bin ich wirklich zu Hause.“ Aus Erlenholz hat er einen kleinen Löffel mit geschwungenem Griff geschnitzt und glatt geschmirgelt, mit viel mehr Zeit als früher. Weil nichts und niemand ihn drängte.
Anders als andere
Auch Friedmunt spürte schon als Kind, dass er „anders“ ist, irgendwie nicht „passte“. Aus einer Kölner Reihenhaussiedlung, „wo ein Haus wie das andere war“, flüchtete er mit dem Fahrrad in den Wald. „Mit dreizehn wusste ich ganz genau, dass der westliche Konsum nicht meins ist.“ Popmusik, Motorräder, das war ihm alles egal. Zumal ihm bei einem Schwarzwaldurlaub das „Herz aufging“: „Ich war verliebt, aber nicht in ein Mädchen, sondern in die Natur. Hier gehöre ich hin.“ Schon sein Großvater war vor rund hundert Jahren in der Wandervogelbewegung aktiv gewesen. Friedmunt Sonnemann ging den Weg ganz. Er verzichtete auf nichts, ließ nichts hinter sich, was er je vermissen könnte, gab nichts auf. Er fand. Heute gehört die Farm ihm, die er zuvor von einem Longkamper Bauern pachtete. Er bot sie ihm an, „und das war ein Zeichen für mich“.

So wie er sich früher in ferne Länder träumte, züchtet er heute auf insgesamt rund 4.000 Quadratmetern mehr als hundert verschiedene Kräuter und Gemüsesorten aus aller Welt. In der Gleichmütigkeit des Waldes braucht er die Abwechslung durch immer mal wieder wechselnde und ungewöhnliche Pflanzen. Aus Deutschland hat er nur Mangold Hunsrücker Schnitt, und selbst der muss gerade erst wieder neue Samen produzieren.
Roter Aztekenspinat
Über den Internetversand Dreschflegel können Haus- und Kleingärtner von ihm derzeit unter anderem die Wildtomate Humboldtii beziehen, die eigentlich aus Venezuela kommt, der Krautfäule nicht so viel anhaben kann und deren aromatische Früchte mirabellengroß werden. Außerdem Echtes Herzgespann, ein rosa Lippenblütler, der früher viel in Bauern- und Klostergärten wuchs und heute noch gegen allerlei Herzbeschwerden eingesetzt wird. Ein Imker sagte Friedmunt einmal, dass seine Bienen darauf fliegen. „Kennenlernangebot“ in diesem Jahr ist Huazontle: Roter Aztekenspinat mit einem Blütenstand wie Brokkoli und roter Reifefärbung der Blätter. Zuvor wenig beachtet, verkauft er sich so erfolgreich, dass Friedmunt allmählich die Tütchen mit Samen ausgehen, die er hinten in seinem Häuschen in einer Vielzahl kleiner Kisten verwahrt – alles handbeschriftet. Kann sein, dass er bald wieder neue nachziehen muss.
Mit seinen lehmfarbenen Hosen und dem etwas helleren Pullover scheint er selbst direkt aus der Erde zu wachsen.
Für die Feinsaaten hat Friedmunt schon früh in diesem Jahr ein Stück Erde vorbereitet, „damit erst mal alles hochkommt, was noch da ist“. Braun und trocken liegt es in der Sonne, unterhalb der Bohnenstangen. Nur hier und da keimt jetzt noch ein zartes Pflänzchen. Um auch sie herauszuholen, kniet Friedmunt auf der Erde, sitzt auf seinen bloßen Fersen, die Füße wie in einer Yoga-Stellung übereinandergelegt. Mit seinen lehmfarbenen Hosen und dem etwas helleren Pullover scheint er selbst direkt aus der Erde zu wachsen, die langen Haare ihr entgegen. Versonnen zerreibt er lehmige Erdkrumen zwischen den Fingern, um zartes Unkraut herauszulösen. Sanft fällt hier der Hang ab, um gegenüber wieder in den Wald anzusteigen.

Ein Mountainbiker rollt dort über den Weg, und die Stimmen zweier Wanderer dringen herüber. Ansonsten hört man nur die Vögel, ein paar Hummeln summen in den gelben Blüten der Kohlrüben, die so süß duften wie Raps. In ein paar Jahren wird aber voraussichtlich das Grundrauschen der Zivilisation auch bis hierher vordringen, wenn nicht sogar ihr Lärm.
Und dann die Autobahn
Denn in wenigen hundert Meter Entfernung, dort, wo jetzt noch Tannenspitzen am Horizont über den Hang schauen, soll die vierspurige Autobahn verlaufen, die von der geplanten Hochmoselbrücke nach Longkamp führen wird. Das Bauprojekt, das aus den Sechzigerjahren stammt, ist bei Gegnern umstritten. Sie fürchten unter anderem Schäden für den Weinanbau und den Tourismus – und bringen vor, dass die Brücke auf einem instabilen Rutschhang errichtet werde. „Die Brücke wird einstürzen“, ist auch Friedmunt überzeugt. Er engagiert sich seit Jahren gegen den bereits 2009 begonnenen Bau. Wegziehen kommt für ihn jedenfalls nicht infrage:
„Man kann so einen Platz nicht mitnehmen, und ich empfinde es als Teil meiner Lebensaufgabe, an der Transformation dieser Situation mitzuhelfen.“ Er sagt es in seiner ruhigen Art, die ihn nur ab und an die helle Stimme etwas heben lässt.

Bis es so weit ist, bleibt selbst für einen wie ihn das Leben im Wald herausfordernd genug. Auf Land, das er verpachtet hatte, haben Leute kürzlich unwissentlich einen Baum gefällt, den Friedmunt gepflanzt hatte. Vor 30 Jahren. Und als ich ihn eine Woche nach unserem Besuch anrufe, kommt er gerade aus dem Gewächshaus: „Ich bin gestresst!“, sagt Friedmunt. Seine insgesamt 75 Sorten Basilikum, die er dort angezüchtet und auf das oberste Regal gestellt hatte, sind gefressen worden. Und er weiß nicht, von welchem Tier.


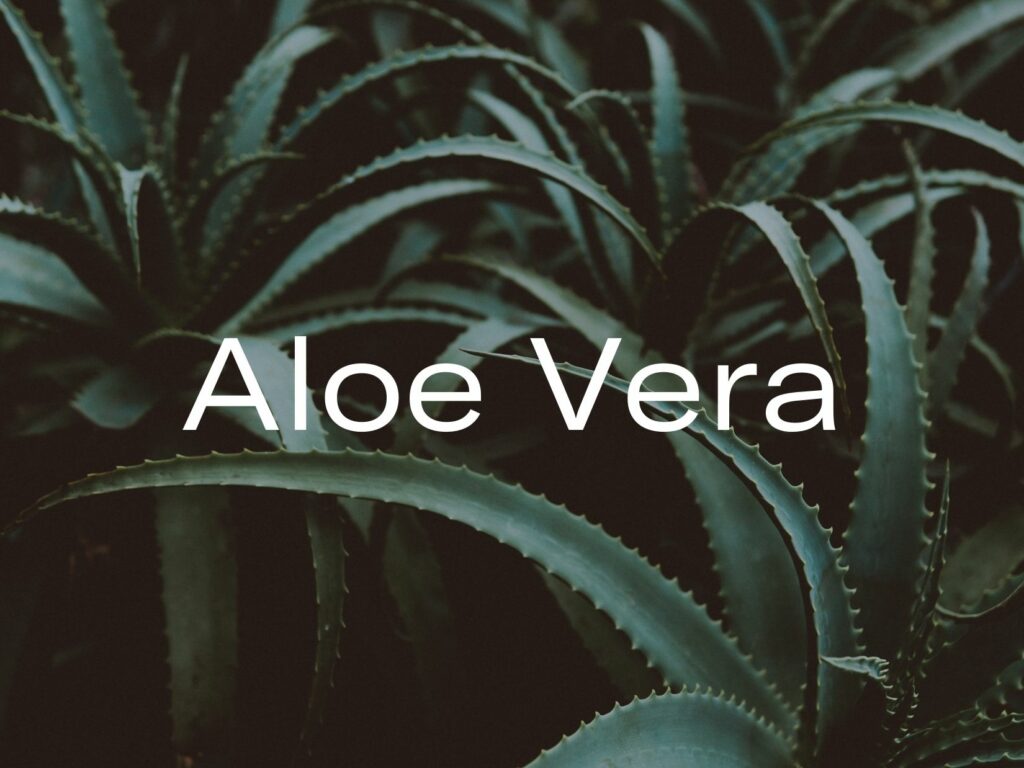
Ganz feiner Bericht über die Königsfarm und ihre Bewohner. Ich kann nur jedem empfehlen Dort mal eine Weile mitzuarbeiten und zu leben. Das habe ich selbst von 1991-2007, war eine schöne zeit mit Schafen, Pferden, Hühnern und Katzen.
Danke für diesen Erfahrungseinblick.
Danke für diesen Bericht.
Auf der Suche nach einer bestimmten Sorte Topinambur wurde ichbei Dreschflegel-Bio-Saatgut fündig und bei dieser Gelegenheit erfuhr ich von Friedmunt Sonnemann und seine Königsfarm in Longkamp und wie er dort lebt. Respekt!!! vor einem Menschen mit solcher Achtsamkeit!!!
Auf La Réunion im Indischen Ozean habe ich in einem tropischen Vulkankrater einen Menschen getroffen, der wie Friedmund Sonnemann lebt, Bernard. Ab und zu stellt er sich an
einen Pfad an der Kraterkante und freut sich, wenn er dort einen Menschen trifft. Er lud mich und meine Frau auf eine Tasse Tee zu sich ein. Sein Lehmhaus war noch einen ganzen Tagesmarsch von unserem Treffpunkt entfernt und so erreichten wir seine Farm unterhalb des Steilhanges erst am nächsten Mittag. Bernard zeigte uns sein Lehmhaus und seinen Garten, den er nach Art Permakultur bearbeitet. Ich war sehr beeindruckt von diesem Menschen und seiner genügsamen Lebensweise.
Von Friedmunt Sonnemann lasse ich mir die Topinamburpflanzen nicht zusenden, nein,
ich werde ihn besuchen und vielleicht kann ich ein paar Knollen bei ihm an Ort und Stelle
kaufen. Ich freue mich ihn bei dieser Gelegenheit kennen zu lernen.
Mich fasziniert dieser Lebensstil von Friedmunt.
Würde so gerne mal dort für eine unbestimmt Zeit leben.
Bedarf das eine vorherige Anmeldung.
Mit herzlich lieben Grüßen an Friemunt.
Brigitte
Toller Beitrag. Gab es dem auch in einer Printausgabe des Magazins oder andere Berichte über die Farm?
Ich bin begeistert von solch einen naturverbunden Lebensstil. Lg